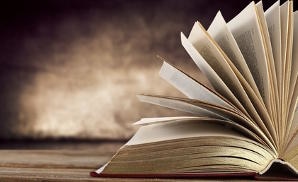 „Ich hab mich gerade mit der Stadt versöhnt.“ Iris Thiel kommt mir nicht wie erwartet aus der Bahnhofshalle, sondern aus der Fußgängerzone entgegen. Vor über 20 Jahren zog sie aus der beschaulichen Schweiz zum Studium nach Deutschland – und war schockiert. Die Stadt erschien ihr bedrohlich, die Konkurrenz untereinander war groß. Mitte Vierzig ist sie jetzt, könnte durchaus für Mitte Zwanzig gehalten werden. Sie trägt eine dunkle Samthose mit Blumenmuster, flache graue Schuhe, ein rotes Shirt, darüber eine graue Strickjacke und eine hellblaue Regenjacke, einfach, bequem, praktisch. Den Hals wärmt ein blauer Schal. Der strubbelige braune Pagenkopf und die eckige Brille wirken fast mädchenhaft, allein eine kleine steile Falte über der Nasenwurzel lässt erahnen, dass sie keine Studentin mehr ist. Leichtfüßig geht sie neben mir her, als würde sie sich mit jedem Schritt lieber vom Boden abstoßen, als zu lange auf ihm zu verweilen. Tänzerin wollte sie damals werden, ihren großen Traum verwirklichen, erzählt sie, während wir im Garten des vegetarischen Restaurants Platz nehmen.
„Ich hab mich gerade mit der Stadt versöhnt.“ Iris Thiel kommt mir nicht wie erwartet aus der Bahnhofshalle, sondern aus der Fußgängerzone entgegen. Vor über 20 Jahren zog sie aus der beschaulichen Schweiz zum Studium nach Deutschland – und war schockiert. Die Stadt erschien ihr bedrohlich, die Konkurrenz untereinander war groß. Mitte Vierzig ist sie jetzt, könnte durchaus für Mitte Zwanzig gehalten werden. Sie trägt eine dunkle Samthose mit Blumenmuster, flache graue Schuhe, ein rotes Shirt, darüber eine graue Strickjacke und eine hellblaue Regenjacke, einfach, bequem, praktisch. Den Hals wärmt ein blauer Schal. Der strubbelige braune Pagenkopf und die eckige Brille wirken fast mädchenhaft, allein eine kleine steile Falte über der Nasenwurzel lässt erahnen, dass sie keine Studentin mehr ist. Leichtfüßig geht sie neben mir her, als würde sie sich mit jedem Schritt lieber vom Boden abstoßen, als zu lange auf ihm zu verweilen. Tänzerin wollte sie damals werden, ihren großen Traum verwirklichen, erzählt sie, während wir im Garten des vegetarischen Restaurants Platz nehmen.
„Ich habe immer nur gelitten und hatte keine Ahnung, was mit mir los ist“, beginnt sie. „Mein ganzes Leben lang habe ich mich einsam gefühlt und gedacht, dass alle in Ordnung sind und nur mit mir etwas nicht stimmt.“ Das Thema Hochsensibilität begegnete ihr zum ersten Mal vor drei Jahren. Hatte sie davor noch auf Heilung gehofft, trug sie jetzt ein Etikett, das sich nicht mehr entfernen ließ. Das anzunehmen war ein langer Prozess. Iris Thiel spricht leise, mit kaum merklichem Akzent, isst bewusst langsam, lächelt zurückhaltend. Als Primaballerina, die trotz Lampenfiebers physische, psychische und künstlerische Höchstleistung im Scheinwerferlicht der Bühne abruft, kann ich sie mir schlecht vorstellen.
„Mein Vater hat die Ausbildung hier an der Musikhochschule zwar finanziert, war aber dagegen. Er hat mich nie tanzen sehen“, bedauert sie. Vielleicht ahnte er die Strapazen, denen seine Tochter sich aussetzen würde, den Druck, die Existenzangst, den erbitterten Kampf um die besten Rollen. „Ich wollte es unbedingt, aber es war zu hart für mich, vor allem menschlich“, urteilt Iris Thiel heute. „Die Mädchen haben sich sogar mit den Spitzenschuhen geprügelt. Anfangs waren wir 15, am Schluss noch fünf.“ Eifersucht und Missgunst waren an der Tagesordnung, kein Klima für eine eher introvertierte Hochsensible. In der Welt der Kunst zu leben, zu den Klängen der Musik göttergleich im Äther zu wandeln und das Publikum zu verzaubern, davon träumte sie. Ernüchtert musste sie feststellen, dass man sie trotz guter Leistungen nicht als Bühnentyp beurteilte – zu wenig Ehrgeiz, zu wenig Biss. „Es gibt kein Leben für mich ohne Tanz, das war ein Weltuntergang. Eigentlich wollte ich keinen der üblichen Berufe ergreifen, sondern in meiner Welt leben, aber ich bin ziemlich auf die Nase gefallen“, muss sie sich eingestehen. „Die künstlerischen Berufe sind heute ganz hartes Business.“
Erste Ballettstunden erhielt sie erst mit 11 Jahren, zu spät für eine Bühnenkarriere. Schon damals kämpfte sie gegen entmutigende Kommentare an: „Das schaffst du nicht mehr. Du bist zu alt.“ Sie biss sich durch, verfolgte hartnäckig ihr Ziel und litt. Ein Jahr vor der Abschlussprüfung packte sie und fuhr zurück nach Hause. Iris Thiel schlug den Weg ein, den ihr Vater für sie vorgesehen hatte. „Wenn du die höhere Handelsschule absolvierst, zahle ich anschließend deine Tanzausbildung.“ Das war damals seine Bedingung. Heute ist sie froh über das zweite Standbein, das sich ihr so eröffnete: „Im Nachhinein sehe ich, dass es gut für mich war. Eltern wissen schon, wie das Leben aussieht“, räumt sie ein. Dennoch blieb sie innerlich auf der Suche nach dem Besonderen, dem Speziellen, ein einfacher Bürojob wäre einer inneren Kapitulation gleichgekommen. Zwei Jahre lang unterrichtete sie Tanz, lebte mehr schlecht als recht, bis die Entscheidung im Raum stand, eine Ballettschule zu übernehmen. Sie zögerte, wollte sich nicht festlegen und reiste erst einmal nach Spanien, um die Sprache zu studieren und Übersetzerin zu werden. Nebenbei wollte sie sich im Flamenco üben – ein Chassé zur Seite auf der Bühne ihres Lebens. „Im Sommer bin ich einen Monat dort gewesen und es hat mich einfach gepackt. Ich wusste, jetzt kommt das Nächste. Daraus sind drei Jahre Spanien geworden.“
Sie lebte bei einer netten Familie, aber für den Flamenco war sie nicht am richtigen Ort. Wieder kämpfte sie um ihren Studienplatz, setzte sich mit der spanischen Bürokratie auseinander, bis sie fast zusammenbrach: Schwindel, Sehstörungen und Übelkeit gaben ihr jeden Morgen das Gefühl, keine Kraft mehr zu haben. Aufgeben wollte sie dennoch nicht, überforderte sich und ging über ihre Grenzen. Iris Thiel kehrte zum zweiten Mal in die Schweiz zurück. Aber diesmal bot ihre Heimat ihr kein Zuhause mehr, die Ehe der Eltern war zerbrochen, ihre Freunde hatten sich von entfremdet, sie fühlte sich völlig auf sich gestellt, einsamer denn je. Es ging ihr schlecht. Heute fragt sie sich, warum sie sich damals keine Hilfe holte. Vielleicht hatte sie sich an das Gefühl gewöhnt, permanent kämpfen zu müssen, sich zu verausgaben und zu erschöpfen. „Du hast nur dich und du schaffst das“, war ihr Motto. Vielleicht wuchsen ihr auf diesem Weg auch neue Kräfte zu.
Sie suchte sich einen Brotjob, ging arbeiten, kam nach Hause, legte sich vor den Fernseher, ging schlafen, riss sich zusammen, ging zur Arbeit, ging schlafen. Für mehr Leben reichte es nicht. Zwei Jahre dauerte es, bis sie sich wieder besser fühlte. Was ihr in der Zeit Kraft gab? „Immer hörte ich die Stimme in mir, die sagte: ,Du schaffst das‘“,sagt sie und isst ein wenig. Wir schweigen.
„Dann habe ich die Stelle gewechselt, wollte etwas anderes sehen, aber es ging schief“, erinnert sie sich. „Das ist immer so: Eine Stelle muss stimmen, sonst geht es nicht. Und das kann ich vorher nicht testen.“ Das erträumte Flair von Weltoffenheit und dem Gebrauch ihrer Spanischkenntnisse sah sie in dem großen Exportunternehmen schnell enttäuscht: Stupide gab sie stundenlang Zahlen in Bestandslisten ein. Herzliche Kollegen, eine vertrauensvolle Atmosphäre und eine Rückzugsmöglichkeit, um unbeobachtet und selbstständig arbeiten zu können, das sind wesentliche Kriterien für Iris Thiel, um sich wohl zu fühlen. Sie braucht einen Vorschuss an Sympathie, dann steigt sie ein und gibt ihr Bestes. Lange zweifelte sie an sich selbst, verlangte von sich zu funktionieren, diszipliniert, gnadenlos. Ihr Regal ist gefüllt mit Selbsthilfe-Büchern, geholfen haben sie ihr nicht. Wieder fühlte sie sich beobachtet, bewertet und für nicht gut genug befunden. Wieder hatte sie das Gefühl zu versagen, stellte sich die Frage, wie es weitergehen sollte.
Sie kündigte und wechselte nach einer kurzen Episode in einer Zeitarbeitsfirma die Branche: Contretemps – Richtungswechsel. Sie ging zu einem Konzern für Schweizer Käse, und musste am ersten Arbeitstag feststellen, dass die Kollegen sie misstrauisch beäugten und hinter ihrem Rücken über sie redeten. „Das kostet so viel Kraft“, sagt sie. Ihr Essen ist längst kalt. Es macht ihr nichts aus. Sie hat sich dazu erzogen, alles in Ruhe zu machen. „Fünf Monate später habe ich gekündigt. Ich konnte nicht mehr.“ Wen sollte sie wegen fehlender Atmosphäre verklagen, welcher Betriebsrat hätte sie gegen mangelnde Sympathie seitens der Kollegen schützen können? Iris Thiel stand wieder mit dem Rücken zur Wand, die Angst um ihre Existenz im Nacken. In Bewerbungsgesprächen verkauft sie sich als kompetent, motiviert und teamfähig. „Ich hab nie Angst, solange sie mich nicht einstellen, kann mir nichts passieren“, schmunzelt sie. „Wieder zu Hause angekommen, denke ich, dass ich das nicht leisten kann.“
Über eine Stellenvermittlung erhielt sie Arbeit in einer Baufirma und landete einen Glückstreffer: „Ganz liebe Menschen, abwechslungsreiche Arbeit, ich wollte mir nicht mehr antun, die Stelle zu wechseln.“ Sie hoffte endlich anzukommen, blieb elf Jahre und überhörte anfangs noch geflissentlich die Fragen und Zweifel, die an ihr nagten. Sollte das alles gewesen sein? Wo blieb das Besondere, das sie vermisste, das ihr wirklich entsprach? Das Gefühl, ihr Leben zu verpassen, wurde stärker. Neben dem Beruf tanzte sie Flamenco, lernte Gitarre spielen, fand darin die ersehnte Erfüllung.
„Nach elf Jahren habe ich beschlossen zu kündigen. Das war ein Prozess von vier Jahren: Ich trau mich, ich trau mich nicht.“ Iris Thiel zögerte lange, das angenehme Umfeld aufzugeben. Einerseits verdiente sie gut, wusste, was zu tun war, und mochte die Kollegen. Andererseits zeigte ihr Körper mit deutlichen Symptomen, dass etwas nicht stimmte. „Ich habe meine Maske aufgesetzt und mich zusammengerissen. In der Zeit war ich oft beim Arzt, aber ich konnte mich niemandem anvertrauen“, gibt sie offen zu. Sie ging zwar zu Vorstellungsgesprächen, sagte anschließend aber die Offerten wieder ab, bis sie eine Stelle in der Medienbranche erhielt, ein kreatives Umfeld, das ihr spannend erschien.
„Das war der absolute Horror! Dort gab es kaum Struktur“, musste sie schnell feststellen. Sie war vom Regen in die Traufe geraten. Der große Stress überforderte sie schnell. Sie ging abends erschöpft nach Hause und stand morgens müde wieder auf. Als sie mit Grippe im Bett lag, bot man ihr eine Stundenreduktion an. Aber Iris Thiel wollte nicht klein beigeben. Schließlich ging es um ihre Existenz. Sie erhielt die Kündigung und eine Abfindung. „Es war mir egal. Innerhalb von fünf Minuten war ich eine große Sorge los“, lacht sie.
Was schon einmal als passabler Weg erschien, um dem Auf und Ab von Jobwechsel und Kündigung zu entkommen, sollte ihr diesmal wieder neuen Elan geben: ein Auslandsaufenthalt. Iris Thiel ging für zwei Monate nach Frankreich, um ihre Sprachkenntnisse aufzufrischen. Als wagemutig oder abenteuerlustig sieht sie sich nicht. „Ich hab viel Angst, aber wenn ich etwas will, dann muss es passieren“, erklärt sie. Vordergründig suchte sie ihre Chancen im Beruf zu verbessern, insgeheim trieb sie die Suche nach dem inneren Glück an. Zurück in der Schweiz, sah es zunächst so aus, als wäre ihr Plan aufgegangen: Sie erhielt Einladungen zu 20 Vorstellungsgesprächen. Aber Iris Thiel traute sich nicht mehr, eine Stelle anzunehmen. Zu schmerzlich waren die Erfahrungen der vergangenen Jahre, sich immer wieder einzulassen, die innere Unruhe zu fühlen und mit dem Gefühl, keinen Platz in der Welt zu finden, heimatlos zurückzubleiben. „Ich kann nicht unendlich viel leisten und muss immer schauen, ob ich das schaffe“, sagt sie. Die Angst vor dem Versagen war groß, ihr Selbstwertgefühl schwach. „Ich kann nichts, ich habe immer versagt. Ich kann gerade überleben“, verurteilt sie sich. Ihre Hochsensibilität erlebt sie als Feind im Innern, als Strafe, die sie daran hindert, sich zu entfalten, als permanenten Kampf.
Wie viel sie bereits gemeistert hat, sieht sie nicht, denke ich. Folgerichtig sagte sie herausfordernde Positionen ab und suchte sich eine Arbeit, die sie von den Anforderungen her bereits kannte und innerlich Atem holen lassen sollte. Sie fühlte sich einsam, machte sich größte Vorwürfe. „Warum funktioniert es nicht, wenn ich doch mutig Neuanfänge wage und alles gebe?“, fragte sie sich verzweifelt. „Ich bin durchaus leistungsfähig, wenn die Bedingungen stimmen.“ Fünf Monate hielt sie durch, diszipliniert, willensstark und unglücklich. Dann wechselte sie die Branche. Jetzt arbeitet sie mit einem guten Chef in einem netten Team, fühlt sich angekommen, kann sich endlich entfalten.
Sie hätte sich gewünscht, ihr künstlerisches Talent zu verwirklichen. Sie hätte sich mehr Unterstützung erhofft. Mit einem Mann an ihrer Seite wäre es leichter gewesen, denkt sie – Pas de deux. „Bisher habe ich noch niemanden getroffen, der mich so versteht.“ Sie fühlt sich doppelt so stark belastet wie andere. Sie muss für ihre Gesundheit sorgen, ihre Arbeitskraft erhalten, ihre Existenz sichern, ganz allein. Manchmal erlebt sie ihre Hochsensibilität als Strafe, oft als Last, selten als Gabe. Vielleicht wird ihr noch einmal die Liebe begegnen, hofft sie. „Ich glaube daran, dass ich diesem besonderen Menschen noch begegnen werde“, sagt sie und lächelt. Immerhin hat sie kurz vor unserer Verabredung einen Kollegen ins Vertrauen gezogen, der sich dafür interessierte, was sie in Deutschland zu tun hätte. „Ich sag dir jetzt etwas. Du bist der erste Mensch, der das weiß: Ich bin hochsensibel“, wagte sie sich vor. „Er war sehr interessiert und das war ein gutes Gefühl.“ Sich nicht mehr verstecken zu müssen, die Maske der vermeintlichen Stärke abzunehmen und sich akzeptiert zu fühlen war eine Erfahrung, die sie erstaunt hat.
Es wird langsam kühl im Garten. Wir wechseln den Platz und setzen uns zu einer Dame an den großen runden Tisch. Lautes Stimmengewirr und klapperndes Geschirr machen ein ruhiges Gespräch fast unmöglich. Ich frage mich, wann Iris Thiel aus der Haut fährt, mache mir Sorgen, ob ich ihr zu viel zumute. Sie widmet sich in Ruhe ihrem Essen, während die Dame ein ausgiebiges Schwätzchen mit einer Bekannten, die vor unserem Tisch stehen bleibt, hält. „Das Wort hochsensibel stört mich“, nimmt Iris Thiel das Gespräch wieder auf. „Es müsste einen komplizierten Begriff geben, der andere dazu veranlasst, mehr erfahren zu wollen.“
Iris Thiel muss mit ihrer Energie haushalten. Was für andere eine Kleinigkeit ist, wühlt sie auf. Es geht darum, den Tag durchzustehen. Am besten gelingt ihr das mit Achtsamkeit, Affirmationen und Meditation. Alles Künstlerische gibt ihr Kraft. Für Freundschaften bleibt nicht mehr viel Raum. Sie geht auf Distanz, wenn sie spürt, dass man zu viel von ihr verlangen könnte. Die Dame an unserem Tisch hebt die Stimme, um ihre Bekannte zu verabschieden und einen Herrn an ihre Seite zu bitten. Iris Thiel spricht ruhig weiter. Der Lärm scheint sie nicht aus der Fassung zu bringen. Vielleicht sollte ich auch meditieren, denke ich und schlage vor, nochmals den Tisch zu wechseln. Wir bleiben gemeinsam in Bewegung – auf der permanenten Suche nach den besten Bedingungen und dem richtigen Platz.
Iris Thiel will endlich zu sich stehen, will sich öffnen und von ihren Erfahrungen als Hochsensible erzählen. Seit ihrer Kindheit lebt sie in dem Gefühl, nicht normal zu sein. „Das Nervensystem ist überreizt“, sagte der Arzt damals in den Siebzigerjahren und wusste nicht, wie man der Kleinen helfen sollte. „Es war immer klar, dass das niemand wissen durfte. Aber jetzt will ich endlich darüber sprechen. Und wenn es in einem Buch steht, werden andere Hochsensible sich verstanden fühlen und wird das Thema vielleicht ernst genommen“, hofft sie.
Der Wille, Großes zu leisten, ist stark, aber ihre Hochsensibilität setzt ihr Grenzen, die sie nicht überschreiten kann, ohne überreizt zu sein. Iris Thiel hat ihre Wohnung als warme Rückzugsoase ganz individuell gestaltet. Das Schönste für sie: Tür zu – Ruhe. Sie mag Gesellschaft, erzählt lebhaft und gerne. Aber wenn ihre Kräfte nachlassen, sie das Gefühl hat, innerlich zu schrumpfen, muss sie sofort gehen können. Medikamente nimmt sie nicht. Ein Glas Wein, ab und zu etwas Fleisch, das beruhigt und erdet. Sie will es schaffen, aus eigener Kraft. Zurzeit absolviert sie eine Coachingausbildung, erlebt, dass sie nicht länger ausgeschlossen ist, sondern ihr vermeintlicher Makel als Potenzial anerkannt wird. „Ich möchte nur von dir gecoacht werden. Du hast so ein gutes Gefühl für Menschen“, sagte eine Teilnehmerin ihr. Iris Thiel strahlt. „Ich kann das.“ Die neue Herausforderung könnte heißen: Steh zu dir und gehöre trotzdem zu den anderen. Es ist ihr ein Anliegen, sich für andere Hochsensible stark zu machen, mit ihnen in die Tiefe zu gehen. Bald beginnt sie mit ersten Coachings. Vielleicht wird sie Bewegung und Tanz wieder aufgreifen, andere an der Fülle ihrer Erfahrungen teilhaben lassen und so bei sich und in der Welt der anderen ankommen.
„Ich möchte so gerne ein Ganzes werden, immer mehr loslassen und ein Teil von dieser Welt sein. Ich war so lange von allem abgeschnitten“, sagt sie leise. Ein Spatz fliegt in den Raum, verirrt sich, flattert aufgeregt und findet schließlich den Weg zurück ins Freie. Iris Thiel sieht ihm nach. Als Kind stand sie am Fenster, schaute in den Sternenhimmel und spürte, dass es etwas geben muss, was alles bewegt. „Ich weiß, es gibt diese Kraft, von der man nehmen kann, die größer ist als wir. Man braucht auch Vertrauen ins Leben.“ Mir kommen die Tränen. „Ich habe genug gelitten, mich weit von mir entfernt. Heute habe ich mehr Kraft als früher, bin näher bei mir. In zehn Jahren möchte ich ganz ich selbst sein, einfach angekommen“, schließt sie. Sie wird sich ihren Weg bahnen, achtsam, neugierig und entschlossen – eine Primaballerina auf der Bühne des Lebens, die berührt.
